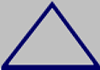 |
Ruine Hardenstein in Witten-HerbedeHardensteiner Weg |
 |
|
|
Eine halbe Stunde von Steinhausen liegt im Tale, von bewaldeten Bergeshöhen überragt, die Ruine Hardenstein, um welche die Sage die Geschichte vom Zwergenkönig Goldemar spinnt. Karl der Große soll die Burg dem trotzigen Sachsenführer Wittekind nach dessen Taufe geschenkt haben. Doch hat um diese Zeit hier noch kein festes Haus gestanden, vielmehr ist es erst im 14. Jahrhundert gebaut worden. Um 1355 verkaufen nämlich die Dynasten von Hardenberg ihren alten Stammsitz bei Neviges an den Grafen von Berg und wandern nach dem Hartenstein im schönen Tale der Ruhr aus. Sie nennen sich anfänglich nach dem Schlosse ihrer Väter von Hardenberg, nehmen aber schon bald den Namen Hardenstein an. Heinrich III. von Hardenstein starb 1369 und hinterließ zwei Söhne Neveling und Heinrich, beide recht kriegerische Naturen. Mit ihren Vettern von Oefte begeben sie sich in den Dienst des Erzbischofs von Köln und stehen diesen im Kampf mit der Stadt Köln bei. Bald darauf schon helfen sie aber den Kölnern gegen den Erzbischof. Der Jüngere hat dann 1378 eine Fehde mit der Stadt Dortmund. Er hatte nämlich von einem dort wohnenden Juden eine größere Summe Geldes geliehen. Da er sich weigerte zu zahlen verklagte ihn der Jude beim Rate der Stadt. Dieser forderte Heinrich zur Zahlung auf. Das aber war dem stolzen Junker zu viel. Rasch war ein Bündnis mit gleichgesinnten Freunden geschlossen, und sie sagten der Stadt Dortmund Fehde an. Mit 1000 Bewaffneten zogen sie dorthin und gedachten, leichten Kaufes die alte Hansestadt überrumpeln zu können. Aber die hatten feste Mauern und starke Tore, die gut bewacht wurden. Da ersannen die streitlustigen Herren eine List. Rötger von Gysenberg schlich sich verkleidet in die Stadt in die Wohnung seiner Freundin, der Gräfin von Vierbecke. Mit ihr beredete er folgenden Plan: Am Michaelistage sollten zwei hoch beladene Fuhren mit Heu, unter dem sich Bewaffnete versteckt hielten, durch das Wissstraßentor hineingelassen werden. Sobald die Torflügel geöffnet waren, musste die Gräfin ein Zeichen mit einem Tuche geben; dann wollten die Freunde aus dem Hinterhalt hervor brechen und in die Stadt eindringen. Der Plan schien zu gelingen. Als der nichtsahnende Wächter die Tore aufschließen wollte, um die Wagen hinein zu lassen, gab die Gräfin vom Torhaus aus das verabredete Zeichen, worauf die Belagerer mit lautem Geschrei heran stürmten aber es war zu früh; die Torflügel waren noch nicht geöffnet. Der Wächter machte Alarm und ein gewaltiger Auflauf entstand. Die Gräfin wurde ergriffen und noch an demselben Tage auf dem Marktplatz verbrannt. Die belagere aber zogen ab. Röttger von Gysenberg viel bald den Dortmundern in die Hände und wurde erdrosselt. Heinrich von Hardenstein aber begann im folgenden Jahre mit seinem Vetter Engelbert eine Fehde gegen den Herzog Wilhelm von Jülich. Dabei wurden beide von den Bundesgenossen desselben, den streitbaren Kölner Bürgern wegen Landfriedensbruch zum Tode verurteilt und enthauptet. Neveling von Hardenstein aber zog sich nach einem Leben voller Abenteuer auf seine Burg zurück und ward ein ruhiger Mann, der sich aber oft bis tief in die Nacht hinein mit allerlei abergläubischen Dingen abgab. Als er eines Abends grübelnd vor dem Kaminfeuer saß, hörte er dass sich die Tür öffnete. Er schaute sich um, doch bemerkte er keinen Menschen. Da sprach eine helle Stimme: "Ich bin der Zwergenkönig Goldemar und will Dir dienen . Damit war der Hardensteiner wohl zufrieden und lud ihn ein zu bleiben. Bald entstand zwischen ihnen ein freundschaftliches Verhältnis; sie aßen an einem Tische und schliefen in einem Bette- Goldemar war dem Burgherren sehr ergeben und stand ihm in seinem Unternehmungen mit Rat und Tat bei, sodass der Hardensteiner in allen Dingen nur Glück hatte. Aber er konnte seinen Gast nicht sehen, eine Tarnkappe machte Goldemar unsichtbar. Doch ließ er zuweilen seine Hände fühlen, die waren weich wie eine Maus und kalt wie eine Froschhaut.
"Aber seine Stimme
lautete den süßen Flöten gleich. Die Mär von der Anwesenheit des Königs der Zwerge verbreitete sich in der ganzen Umgegend, und täglich hatte der Hardensteiner Besuch von Damen und Herren der Ritterschaft die mit Goldemar bekannt werden wollten. Man saß mit ihm zu Tisch, mit trank mit ihm Wein, man würfelte mit dem unsichtbaren Gast und überhäufte ihn mit Fragen. Wenn man ihn aber necken wollte, so kam man ja übel an. Der Kobold erzählte dann kleine Vergehen aus dem Leben der Besucher, sodass diese erschraken und oft schamrot wurden. Dann aber war er auch wieder schnell versöhnt, schlug wunderbar die Harfe und sang wehmütige Lieder von Liebe und Sehnsucht. Es war bald offenbar, dass sein Gesang der schönen Golalinde galt, die bei ihrem Onkel weilte. Nachdem Goldemer drei Jahre auf dem Hardenstein gewohnt hatte, war er eines Tages mit Gotalinde verschwunden. Der westfälische Geschichtsschreiber von Steinen gibt die Sage in anderer Form: Von dem Hause Hardenstein wird die heydnische Fabel erzählet, dass sich vor Zeiten ein Erdmängen aufgehalten, welches sich König Volmar gemeldet und diejenige Kammer bewohnt hättet, welche von den heydnischen Zeiten bis auf den heutigen Tag Volmars Kammer heißt. Dieser Volmar musste jederzeit einen Platz am Tische und einen für sein Pferd im Stalle haben, da denn auch jederzeit die Speisen, wie auch Hafer und Heu verzehret wurden, von Menschen und Pferden aber sah man nichts als den Schatten. Nun trug es sich zu, dass auf diesem Hause ein Küchenjunge war, welcher begierig seyende, diesen Volmar, wenigstens seine Fußstapfen zu sehen, hin und wieder Erbsen und Asche streute, um in solcher Gestalt fallend zu machen. Allein es wurde sein Vorwitz sehr übel bezahlet; denn auf einen gewissen Morgen, als dieser Knabe das Feuer anzündet, kam Volmar, brach ihm den Hals und hieb ihn zu Stücken, da er die Brust an einen Spieß steckte briet, etliches röstete, das Haupt aber nebst den Beinen kochte. Als der Koch bei seinem Eintritt in die Küche dieses erblickte, wurde er sehr erschrocken und durfte sich nicht in die Küche wagen. Sobald die Gerichte fertig, wurden solche auf Volmars Kammer getragen, da man denn hörete, dass sie unter Freudengeschrey und einer schönen Musik verzehret wurden. Und nach dieser Zeit hat man den König Volmar nicht mehr verspühret, über seiner Kammertür aber war geschrieben, dass das Haus künftig so unglücklich seyn sollte, als es bishero glücklich gewesen wäre, auch dass die Güter versplittert und nicht ehender wieder zusammen kommen solten, bis das drey Hardenberge von Hardenstein im Leben seyn würden.
Der Spieß und Rost sind
lange zum Gedächtnis verwahret, aber 1651, als die Lotharinger in
diesen Gegenden hauseten, weggeplündert wurden, der Topf aber, der
auf der Küchen eingemauret ist, ist heute noch (1760) vorhanden."
Die einsame Lage der Ruine, fest an den Bergen, ohne eigentlichen Zugangsweg, macht, dass Hardenstein, wo die schönste Ruine an der Ruhr, so wenig gekannt ist. Wer aber einmal an einem späten Herbstnachmittage, wenn die feuchten Ruhrnebel wie Geistergewänder den Hardenstein einhüllen und in den Zweigen der Bäume der Wind spielt, vor der Burg weilt, der ist bald im Banne der Sage und glaubt in dem dunklen Gemäuer Goldemar mit seiner Zwergenschar ihr unheimliches Wesen treiben zu sehen. Lenhäuser, A.. Klöster, Burgen und feste Häuser an der Ruhr. Von Hohensyburg bis zur Ruhrmündung. Essen 1924
Kreis- und
Stadt-Handbücher des Westfälischen Heimatbundes:
|
|||
