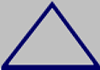 |
Blick auf die Stadt Wetter mit der Ruine der Burg WetterIm Kirchspiel 6 |
 |
|
 Wetter an dem die Ruhr nun vorüber flutet, besteht aus dem Dorfe und der Freiheit, letztere auf einem gegen 130 Meter hohen Felsen des bewaldeten Ardeygebirges gelegen. Ohne Zweifel ist das Dorf älter als die Freiheit. Es wird aus einem Edelhofe entstanden sein, der den Namen Haus Wetter führte und von dem 1214 Friedrich „de Wettere“ urkundlich genannt wird. Im folgenden Jahr gaben er und sein Bruder Bruno ihr Lehnsgut in Lünen an den Bischof Otto von Münster zurück, der es dem Kloster Kappenberg zuwendet. In der Folge werden in Urkunden viele Mitglieder dieser Familie, die recht weite Beziehungen hatte, aufgeführt, und es ist interessant zu wissen, das ein im 14. Jahrhundert nach Mecklenburg ausgewanderter Zweig des Geschlechtes von Mallinckrodt sich dort "von Wetter" nannte. Die Entstehung der Freiheit Wetter geht auf die Isenberg'schen Wirren zurück. Nach der Ermordung des Erzbischofs Engelbert von Köln durch Friedrich von Isenberg, 7. November 1225, hatte sein naher Verwandter, der Graf Adolf III. von der Mark, die größte Eile möglichst viel aus dem Nachlaß des Mörders für sich zu gewinnen. Um dies neue Gebiet gegen den Erzbischof von Köln behaupten zu können, erbaute er 1226 die Burg Blankenstein und der alten Kölnischen Trutzfeste Volmarstein gegenüber die Burg Wetter. Mit der Verteidigung des Platzes betraute er Ritter, die dann als Burgmänner von Wetter auftraten, z.B. von Mallinckrodt, von Ovelacker, von Vaerst, von Wickede, von Boyle, vom Broke und andere. Sie besaßen ja ein festes Haus vor oder in der Burg und dazu Ländereien als Burglehen. Ihnen waren als Hilfe Bürger aus dem Orte beigegeben, welche vom Grafen von der Mark Ackerland und Weiden gegen eine geringe Abgabe erhielten. Sie bauten sich im Schutze der Burg an, und ihre Nachkommen mögen wahrscheinlich noch heute die Freiheit bewohnen. Die errichtete Burg bildete ein Viereck von 50 x 60 Meter Größe; der 26 Meter hohe Bergfried, der drohend ins Land blickt, ist noch gut erhalten. Im Innern war das Verlies in welches Gefangene mit Stricken hinabgelassen wurden. Die Wohnungen der Burgmänner lagen nach Norden, wo selbst ein kleiner Turm stand. Ein Doppeltor an dieser Stelle und eine Zugbrücke über den tiefen Burggraben im Süden waren die einzigen Zugänge. Davor lag die 220 m lange und 120 m breite Vorburg oder Freiheit, mit einem 10 m breiten Wassergraben und starken Mauern bewehrt, die in der jetzigen Burgstraße ein doppeltes Haupttor und an dem zur Ruhr führenden Wege das „Wassertor“ hatte. So waren die Freiheit und Burg Wetter ein wichtiges Bollwerk gegen die jenseits der Ruhr gebietenden Erzbischöfe von Köln, und das Dorf Wetter tritt geschichtlich ganz in den Hintergrund. Die Grafen von der Mark, der Wichtigkeit des festen Platzes eingedenk, gewährten den Bewohnern viele Freiheiten und Rechte und weilten gern in der Burg. Der kriegerische Engelbert III. starb hier am Weihnachtstage 1391 und „ward gen Vrondenbergh geführt zur Begrabniß durch 500 Gewapende umb siner Fiende willen“. Im Kloster Fröndenberg hatten die Grafen von der Mark ihre Ruhestätte. Die Burg wurde im Mittelpunkt eines Gerichtsbezirks, zudem auch Herdecke Volmarstein und Wengern gehörten. Die Bewohner der Freiheit Wetter konnten aber nicht vorgeladen werden, sondern unterstanden dem Bürgermeister und Rat von Wetter. Um 1300 dürfte das Gericht zuerst aufgetreten sein. Aus der Fülle der vorhandenen Urkunden sei die Vollstreckung eines Todesurteils erwähnt, das ein Streiflicht auf das damalige Leben wirft. Peter Lüning aus Schwelm hatte 1694 im Streite seine Frau erschlagen. Er wurde verhaftet und in Ketten in das Gefängnis zu Wetter gebracht, dass ich in der Burg befand. Nachdem das Gericht ihn des Todes schuldig erklärt hatte, führte man ihn aus der Burg auf die Zugbrücke. Dort stand die männliche Einwohnerschaft unter Gewehr, und der Bürgermeister nahm den Mörder in Empfang. Es ward ihm das Todesurteil noch mal verkündet, und nun wurde er von zwei Geistlichen in die Mitte genommen, welche ihm auf seinem letzten Gange Trost zu spenden suchten. Die ganze Gemeinde, Männer, Weiber und Kinder begleiteten den traurigen Zug bis zur Grenze gegen Herdecke hin, woselbst den Verbrecher wieder bewaffnete in Gewahrsam nahmen, ihn auf einen Karren setzen und zur Richtstätte auf dem Haarbrock führten. Dort wurde er gerädert und verscharrt. Seine Liebste mit welcher der Mörder zusammengelebt hatte wurde gezwungen der Hinrichtung beizuwohnen. Dann brachte man sie zum Pranger schlug sie mit Routen und verwies sie des Landes. In der Burg Wetter war auch die Wohnung des Drosten oder Amtmanns des Amtes Wetter. Die Drosten, dem niederen Adel entstammend, hatten ursprünglich für den Tisch ihrer Lehnsherren zu sorgen gehabt später wurde der Name ein bloßer Titel mit dem keine besonderen Leistungen verbunden waren. Sie führten die Verwaltung eines bestimmten Gebietsteiles der Grafschaft Mark, in unserem Falle also des Amtes Wetter. Zu diesem gehörten ungefähr die heutigen Kreise Hagen und Schwelm. Die Drosten beurkundeten Verträge, Vergleiche, Bündnisse, nahmen in Streitigkeiten die Rechte ihres Herren wahr und waren gehalten, in Weigerungsfällen die Stiftseingesessenen von Herdecke mit Gewalt zur Nacheichung der Maße und Gewichte zu zwingen. Aus dem Drosten gingen später der Amtmann und der Landrat hervor. Zum Unterschiede von der „Freiheit“ wurde das Dorf auch „Kerk-Wetter“ genannt, denn neben der aus dem 13. Jh. stammenden Burgkapelle, welche der heiligen Katharina geweiht war, war im Dorfe eine um 1400 gebaute Pfarrkirche, deren Patronat die Grafen von der Mark hatten. An der Kirche bestand die 1345 gestiftete „Bruderschaft unserer lieben Frauen“, die alte Schützengilde. Nur Bürger konnten in diese aufgenommen werden. Um 1550 traten die Bewohner von Wetter zur lutherischen Kirche über. Ein 1629 erfolgter Versuch, mit Hilfe Pfalz-Neuburgischer Truppen die Rückkehr zur katholischen Lehre zu erzwingen, hatte keinen Erfolg vielmehr bürgerte sich das reformierte Bekenntnis ein. 1822 vereinigten sich beide Gemeinden in der Union. Infolge Aufblühens der Industrie nahm die Zahl der Katholiken zu, die 1849 hier eine Missionsvikarie gründeten und 1891 eine prächtige Pfarrkirche erbauten. In Kriegszeiten hatte auch Wetter viel zu leiden. So hören wir, das gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges von 82 Häusern 32 verwüstet waren und der Ort von armen Tagelöhnern und Handwerkern, meist Mauerleuten bewohnt wurde, denen ein Hochwasser die Ernte völlig vernichtet hatte. Langsam erholte sich Wetter; 1714 gab es 98 Haushaltungen mit 346 Einwohnern, welche Messerschmiede und Steinmetzen waren. Die Klingenschmiedeindustrie war 1664 durch den Großen Kurfürsten eingeführt worden. Aber erst nach dem Siebenjährigen Kriege konnte Wetter empor blühen, in dem 1784 ein neuer Gewerbezweig, die Harkort'sche Stahlfrischerei einzog. die 1815 in die verödete Burg verlegt wurde. Diese hatte nämlich, als Wetter dem Landgericht Hagen unterstellt wurde, 1780 das westfälische Bergamt beherbergt, welches 1804 als Oberbergamt nach Essen kam. In der Burg blieb das Märkische Bergamt. Als dieses 1814 nach Bochum übersiedelte, kaufte Friedrich Harkort die verfallenen Burggebäude vom Staat an. Heute zählt Wetter 9539 Einwohner. Im Wappen findet sich der märkische geschachtete Querbalken und darüber die Schutzpatronin des Ortes, die heilige Katharina mit einer neunzinkigen Krone. Neuerdings beabsichtigt die deutsche Maschinenfabrik in Duisburg die heute das Werk Wetter besitzt, das ehemalige Gebäude der Burg mit Beamtenwohnungen zu bebauen. Wetter verdankt seinen Aufschwung den Harkorten'schen Eisenwerken. Friedrich Harkort 1793-1880 entstammte einer Industriellenfamilie auf Haus Harkorten bei Haspe. Er machte die Befreiungskriege mit und widmete sich dann ganz der Industrie. Vorausschauend erkannte er die ungeheure große Zukunft des Dampfes und ging daran, mit Hilfe englischer Ingenieure Dampfmaschinen zu bauen, die als Bohr- und Hobelmaschinen Verwendung fanden. Ihnen folgten die Fördermaschinen, die dem gerade beginnenden Tiefbau der Zechen gewaltige Dienste leisteten. Auch Maschinen für Dampfschiffe gingen aus seiner Fabrik in Wetter hervor. Als einer der ersten legte er bereits 1825 den Städten Pläne zur Anlage von Eisenbahnen vor, welche die märkischen Kohlen und Eisenfabrikate schnell und billig in die deutschen Lande bringen sollten. Aber allerorts begegnete man ihm mit Misstrauen und lachte über den Projektenmacher. Als dann 1848 endlich die Bergisch-Märkische Bahn in Betrieb kam, zu der Harkort die Anregung gegeben hatte, da war niemand froher als er selbst. Überhaupt war ein hervorstechender Zug seines Charakters, in uneigennütziger Weise anderen gutes zu tun. Stolz zeigte er Freunden die Einrichtung seiner Werke und freute sich, wenn an anderen Orten ähnliche Unternehmungen entstanden, ja, er gab sogar Geld her, um solche Fabriken ins Leben zu rufen. Neben der Sorge für den wirtschaftlichen Aufschwung der Grafschaft Mark war es die geistige Hebung und Bildung des Volkes, die seine Tätigkeit in Anspruch nahm. Unvergänglich sind die Verdienste, welche Friedrich Harkort als Privatmann und Parlamentarier sich für die Volksbildung erworben hat. Alle Zeit gab er neue Anregungen und Winke und griff selbst tief in den Geldbeutel, um Schulen zu bauen und tüchtige junge Leute zu Lehrern ausbilden zu lassen. Was aber die nutzbringende Ausbeutung seiner Ideen angeht, so kann man mit Recht sagen, dass er anderen das Bett gemacht hat, in welches sie sich nur hineinzulegen brauchten. So war es eine heilige Pflicht der märkischen Gemeinden, ihrem großen Wohltäter das Harkort-Denkmal zu errichten. Man wählte dazu den „alten Stamm“, der nun Harkortberg heißt und in der Nähe von Wetter aus einem Kranze herrlicher Hügel hervorragt. Das Denkmal ist 1884 erbaut und mit dem Vincke-Denkmal auf Hohensyburg und dem Stein-Denkmal auf dem Kaisberg so recht geeignet, das Andenken an diese drei großen Volksmänner lebendig zu erhalten. Auf dem Harkortberg werden alljährlich im August die großen Volksturnfeste abgehalten. Quelle: Lenhäuser, A.. Klöster, Burgen und feste Häuser an der Ruhr. Von Hohensyburg bis zur Ruhrmündung. Essen 1924
Kreis- und
Stadt-Handbücher des Westfälischen Heimatbundes:
|
|||