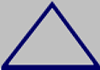 |
Turm in der Burgruine in Wetter-VolmarsteinAm Vorberg |
 |
|
|
Auf einem steil zur Ruhr abfallenden Vorsprung des Ebbegebirges schaut ein alter Turm mit morschem Mauerwerk hinab. Es sind die wenigen Überreste einer stolzen Burg, deren Besitzer durch deutsche Mannestreue sich auszeichneten, schnell emporstiegen, aber nach kurzer Blüte hinabsanken und untergingen. Burg Volmarstein. Sie hat eine so interessante Geschichte, dass es sich verlohnt, etwas weiter auszuholen. Nikolaus Kindlinger, der bedeutendste westfälische Geschichtsforscher, schrieb 1801 ein zweibändiges Werk über die „Geschichte der Familie und Herrschaft Volmestein“, der wir in der Hauptsache folgen, doch nicht ohne die neueren Forschungen zu berücksichtigen. Vorab sei bemerkt, dass der eigentliche Name Volmestein ist, nach dem alten Bett der Volme benannt, deren Spuren man in den sumpfigen Stellen am Kaisberg erkennt. Die alten Urkunden haben die Form Folmudestede, Volmodesten, Vulmunsten, Volmodstein, Volmudestein u. ä. Der jetzige Besitzer schreibt sich infolgedessen von der Recke-Volmerstein. Für die älteste Geschichte des Geschlechtes sind wir auf Vermutungen angewiesen, doch scheint es gewiss zu sein, daß es ein uraltes, freies Geschlecht des Sachsenstammes war, welches den Oberhof „Folmudestede“ besaß, zu dem eine Anzahl Unterhöfe gehörte. Der Besitzer desselben stand in Friedenszeiten dem Hofgericht der Bauerschaft vor und führte in Kriegsläuften die Wehrmannen gegen den Feind. Aus diesem achtbaren Geschlecht, das weithin bekannt war, stammte auch Radbaldus von Volmoidstein, der von 1002 bis 1022 Abt des Klosters Werden war. Die Volmesteiner standen im Dienste der mächtigen Erzbischöfe von Köln, die nach dem Sturze Heinrichs des Löwen auch die Herzogswürde in Westfalen erlangt hatten. Diese werden wohl als die Erbauer der ersten Burg anzusprechen sein, welche sie dann ihren erprobten Volmesteinern als Lehen überließen. Wahrscheinlich geschah dies um das Jahr 1100. Die Volmesteinee waren den Erzbischöfen unbedingt ergeben und an ihrem Hofe gern gesehen. 1184 hatte Gerhard von Volmestein das Schenkenamt inne, 1200 war er Vogt in Köln; und 1216 besaßen sie das Marschallamt. In solchen Würden finden wir sie als geachtete Herren im Deutschen Reiche. 1167 sind die Vertreter der erzbischöflichen Ministerialen und der Bürgerschaft von Köln bei einem Bündnis mit dem Erzbischof von Magdeburg, und als Erzbischof Rainald von Köln in Italien starb, war es kein Geringerer als der Kaiser Friedrich Barbarossa selbst, der einen sehr freundlichen Brief an Heinrich von Volmestein schrieb und ihn veranlasste, für seinen Schützling Philipp von Heinsberg als Erzbischof von Köln einzutreten. Und wirklich wurde auch dieser gewählt. Die Macht und der Einfluss der Volmesteiner, die sie geschickt auszunutzen wussten, stiegen fortwährend. Im Besitze umfangreicher Güter, die sich bis in das Münsterland hinzogen, der Lehnshoheit über eine Anzahl Höfe des niederen Adels, wie von Mallinckrodt, von Dobbe, Vaerst, Ovelacker und andre, des Vemegericht, des Freistuhls zu Volmestein und einer festen Burg, waren sie schon bald aus dem Stande der Ministerialen in den der "Nobilis", der Edelherren gestiegen. Doch haben sie es nicht zur Grafenwürde bringen können, weil eben der Sturz des Geschlechtes zu früh kam. Dagegen gelang es ihnen, infolge ihres Reichtums und Ansehens in gräfliche Familien hineinzuheiraten, was von denen von Limburg, von der Mark, von Dortmund und anderen bezeugt ist. Die Erzbischöfe von Köln aber belohnten die Ergebenheit ihrer Vasallen in der Weise, dass sie den Volmedteinern die Vogteien des Stiftes Herdecke und ihrer Güte bei Soest übertrugen, worauf auch die Klöster Deutz und Siegburg sich an die von Volmestein um Schutz ihrer Besitzungen wandten. Viele Mitglieder der Familie finden wir im Dienste der Kirche. Der Abt Ratbaldus von Werden wurde schon erwähnt. Von einem Gerwinus von Volmundstein wird uns eine rührende Geschichte erzählt. Als wackerer Jüngling verließ er die Burg seiner Väter und zog nach Ritterart in die Fremde. Nach langer Fahrt gelangte er ins Bayerland, wo er mit dem jungen Markgrafen Theobald innige Freundschaft schloss. Zu zweien zogen sie aus, um an Fürstenhöfen im Turnier eine ritterliche Kunst zu zeigen und von edler Frauenhand sich die Stirn mit dem Preise schmücken zu lassen. Bei einem solchen Kampfe traf Gerwinus mit seinem Freund Theobald zusammen und seine Lanze durchbohrte den Hals desselben. Von dem furchtbarsten Schmerz überwältigt, entsagte er dem Rittertum und zog sich in das Kloster Siegburg zurück, um hier in geistlichen Übungen Buße zu tun. Aber Theobald war glücklicherweise nicht tödlich getroffen worden und schon bald wieder hergestellt. Versuche, seinen Freund zu finden blieben ohne Erfolg. So vergingen Jahre. Gerwinus war unterdessen von seinen Ordensobern in das Bayerland geschickt worden, um hier eine neue Ordensniederlassung zu gründen. Da trifft er mit Theobald im Walde zusammen, der seinen alten Waffenbruder an einer Narbe an der Stirn erkennt. Groß war die Freude des Wiedersehens, bis an ihr Lebensende haben Fürst und Mönch wieder innige Freundschaft gehalten. Ein Gottschalk von Volmestein war Domherr in Köln, Eberhard von Volmestein Propst und Kanonikus in Soest, andere bekleideten dieselben Stellen in Köln, Münster und Osnabrück. Von weiblichen Mitgliedern war nach der Überlieferung Frederuna, die Stifterin des Klosters zu Herdecke aus dem Volmestein'schen Geschlecht, wie denn nach Herdecke sehr viele Beziehungen der Volmesteiner gingen. Ständig waren Stiftsdamen aus diesem Geschlechte dort, und einige von ihnen standen den Kloster als Äbtissinnen vor, so Hedwig 1229-1253, Lutgardis 1263-1272 und Mechthild um 1298. Diese Zeit wallfahrte viel Volk zu einer frommen Klausnerin Gertrud von Volmestein, die in der Nähe der väterlichen Burg, im dichten Walde ihre Hütte hatte und um deren Gebet man flehte. Die eigentliche Geschichte der edlen von Volmarstein beginnt mit dem Jahre 1234. Der Besitzer der Burg, Heinich, der mit Sophie von Isenberg vermählt war, hatte seine Vogtsgewalt über dass ihm anvertraute Stift Herdecke und die Besitzungen anderer Abteien missbraucht, und auf diese Weise war das bisherige gute Einvernehmen mit Köln gestört worden. Der damalige Erzbischof Engelbert der heilige wird den Volmesteiner an seine Pflichten erinnert haben, aber er fand einen trotzigen Vasallen, der bald im Bunde mit seinem Schwager, Friedrich von Isenberg, zu den Feinden des Erzbischofs gehörte.Ob er an der Ermordung des letzteren teilgenommen hat, darf bezweifelt werden. Als aber der Nachfolger Engelberts auf dem erzbischöflichen Stuhle Heinrich von Molemark mit Waffengewalt gegen den Mörder und seinen Anhang einschritt, musste auch Heinrich von Volmestein die Rache treffen. Er fiel in Ungnade, und seine Burg wurde ihm genommen. Das "Burggrafenamt" kam an andere Adelige Dienstmannen des Erzbischofs, von denen 1243 Goswin von Menden und Lubbert von Swansbube genannt werden. Das gute Verhältnis von ehedem ward, solange Heinrich lebte, nicht mehr eingestellt. Dagegen finden wir seinen Sohn, Diedrich von Volerstein, wieder in der Gunst des Erzbischofs und dem Besitze der väterlichen Burg. Als in der großen Fehde des Erzbischofs mit den Kölner Bürgern, den Grafen von Berg und von der Mark die Schlacht bei Worringen zu Ungunsten des Erzbischofs ausfiel, musste auch Volmestein die Rache des Siegers fühlen, es wurde 1288 durch den Grafen von der Mark zerstört. Aber im Friedensschlusse vergaß der Erzbischof seinen treuen Vasallen nicht. Dietrich von Volmarstein ward ausdrücklich in denselben eingeschlossen, und 1292 ließ sich der Erzbischof sogar vom deutschen Kaiser die Zusicherung des Aufbaues von Volmestein geben. Wann dieser erfolgte, ist nicht festzustellen, aber der Volmesteiner, welcher den Kaiser und den Erzbischof im Rücken hatte, wird sein Möglichstes getan haben, um wieder in einer festen Burg zu sein. Er starb 1314. Ihm folgte sein Sohn Dietrich der zweite, der wie seine Ahnen ein treuer Anhänger des Erzbischofs war. Diese Treue hat den Untergang von Volmesteins gebracht. Im Jahre 1314 waren aus der Kaiserwahl Ludwig von Bayern und Friedrich von Österreich hervorgegangen. Jeder suchte und fand Anhänger. Zu letzterem hielten Köln, der Volmesteiner und auch Graf Engelbert von der Mark, welche in der Schlacht bei Mühldorf 1322 gegen Ludwig kämpften. Aber dieser siegte. Da verließ Engelbert den Habsburger und trat zur bayerischen Partei über, welche bald am Rhein und in Westfalen vorherrschend wurde. Der Erzbischof saß in seiner festen Stadt Soest, von seinen Feinden eingeschlossen. Das erschien Engelbert als der beste Zeitpunkt, das seiner festen Burg Wetter so bedrohlich gegenüber liegende Volmestein zu zerstören. Die gerade am Rhein weilenden Anhänger des Bayern, nämlich der König Johann von Böhmen und die Grafen von Berg und Jülich schlossen sich dem kriegerischen Unternehmen an, und Montag vor Christi Himmelfahrt 1324 "bestalde (belagerte) Greve Engelbrecht dat Slott Volmensteyn, ind up Sente Jakobs Dag quam he darinne und toebrack (zerstörte) dat." Wenn sich aber die Burg vom 22. Mai bis 25 Juli einer solch starken Macht gegenüber halten konnte, so ist dies ein Beweis sowohl für die Festigkeit der Mauern als auch für den Mut der Verteidiger, die unerschütterlich auf die Hilfe des Erzbischofs warteten. Aber dieser, selbst in Not, konnte ja nicht helfen. Wer die Verteidigung der leitete, ist geschichtlich nicht mitgeteilt, es ist aber wohl bestimmt, dass die Familie Volmarstein sich nicht in ihrem Stammsitze befand, da sie sonst sicher genannt worden wäre. Möglicherweise wari Diedrich schon vorher gestorben oder in der Schlacht bei Mühldorf gefallen, und seine Gattin war mit ihrem unmündigen Sohne Dietrich III. auf ihre Güter im Münsterland geflüchtet. Die stolzen Herren von Volmestein aber waren von ihrer Höhe gestürzt, und wir finden Sie in der Folge wieder unter dem niederen Adel. Die Burg wird wohl kaum völlig zerstört worden sein, dafür war Engelbert von der Mark, der sich hier einen festen Platz schaffen wollte, zu vorsichtig. Wir erfahren nämlich dass Volmestein unter dem Grafen Adolf von der Mark 1340 wieder aufgebaut worden sei, der sie nach einer Fehde mit dem Erzbischof Walram 1345 wieder "schlechtmachen" sollte, aber dies unterlassen hat, denn schon bald wird Volmestein neben Altena, Blankenstein und Wetter als eine der vier Hauptburgen des märkischen Landes genannt. Die Grafen von der Mark aber im Besitze Volmesteins und dessen Lehen hatten ihre Hausmacht um ein Bedeutendes vergrößert. Dietrich III. hatte sich auf die Besitzungen seiner Mutter zurückgezogen, wo er grollend über das Unglück seines Hauses 1350 starb. Sein Sohn Dietrich IV. wurde aber schon bald Lehns- und Burgmann des früheren Feindes seines Geschlechtes, des Grafen Adolf von der Mark, der ihn in den Kreis seiner nächsten Umgebung zog. Er scheint sich mit dem Geschick ausgesöhnt zu haben, denn er schloss mit Adolf eine feste Waffenbrüderschaft und stand diesem treulich in den vielen Fehden bei, so in der großen Fehde gegen die Stadt Dortmund. Als lebenslustiger Ritter war er Schmausereien, Jagden und Lustbarkeiten nicht abhold, so dass er die wenigen geretteten Volmarstein'schen Einkünfte und Güter seines Privatbesitzes verkaufen musste und sein Rentmeister oft nicht wusste, wovon er die Schulden seines Herrn bezahlen sollte. Er starb 1396, und ihm folgte der letzte aus dem Stamme der Volmesteiner: Johann. Mit ihm starb 1429 das Geschlecht aus. Seine Tochter Agnes, die mit Godert von der Recke vermählt war, brachte die Güter an dieses Geschlecht, dass sich später von der Recke-Volmerstein nannte und in den Grafenstand erhoben wurde. Das Wappen der Volmesteiner sind drei von einer roten Kugel ausgehende schwarze Blätter. Das älteste dieser Siegel findet sich bereits 1218. Von Diedrich von Volmestein geht eine Sage im Volke um. Er war ein fehde- und rauflustiger Ritter, der schon manchen armen Bauern getötet hatte. Einst ritt er mit seinem Knechte auf die Jagd. Am Eingange eines Tannenwaldes stand ein Mann und hielt den Hut. "Dich hole der Teufel!" ruft der Volmesteiner, doch wirft er ihm ein Geldstück hin. Erschreckt bemerkt der Knecht dass dieses durch den Hut auf die Erde fällt. "Herr es ist ein Geist!" spricht er, doch da ist die Gestalt schon verschwunden. Weiter geht die Jagd; doch siehe am Wegesrand steht wieder der Mann und bettelt. Da zieht Diedrich die Peitsche und schlägt auf die Gestalt ein, - aber der Streich geht durch leere Luft. Nach einer Stunde steht im Eichendickicht zum dritten Male der Bauer da. Da fasst den wilden Volmesteiner die Wut; mit dem Schwerte will er ihn treffen, aber hohnlachend verschwindet die Gestalt. Voller Grauen lässt der Ritter die Zügel los und das Pferd geht mit ihm durch, ohne dass der Knecht zu folgen vermag. Nach langem Suchen findet er seinen Herrn, von einer Astgabel gefasst, erhängt vor;
"Das
Ross floh unter ihm fort in Hast. Müller von Königswinter. Unterhalb der Burg, neben welcher heute ein Kriegerdenkmal und ein an die Römerzeit erinnern des Schutzhaus steht, liegt die Freiheit Volmarstein. Die Bewohner sind zum Teil als Nachfolger der alten Burgmänner anzusehen, unter welchem Namen sie noch 1750 vorkommen. In früherer Zeit oblag ihnen die Verteidigung der Burg, und dafür hatten sie von den Edlen von Volmestein Freiheit von Schatzung und Diensten erhalten, welche Rechte ihnen später von den Grafen von der Mark bestätigt wurden. Die Häuschen im Orte sind recht sehenswert Quelle: Lenhäuser, A.. Klöster, Burgen und feste Häuser an der Ruhr. Von Hohensyburg bis zur Ruhrmündung. Essen 1924
Kreis- und
Stadt-Handbücher des Westfälischen Heimatbundes:
|
|||
