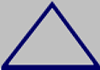 |
Wohnbauten in Wetter-Volmarstein |
 |
|
 Haus Hove am Bahnhof Oberwengern gelegen und aus grünen Obstbäumen hervorlugen, sollte man der frühe über der Tür des Herrenhauses befindlichen Inschrift bis in die fernsten Zeiten ein blühendes Geschlecht sehen; aber schon bald ist es in Trümmer gesunken. Die ersten Besitzer waren die edlen Ritter von Hove; von ihnen kommt das gut an die von Hoete. Von denen 1452 ein Steven von Hoete als Lehnsmann des Herzogs von Kleve-Mark erscheint. Nach 1614 saßen sie auf Hove, wie man aus einer Klagesache des Hermann von Mallinckrodt gegen den Hoete zum Hove hervorgeht. Sie gehörten zu den Edlen der märkischen Ritterschaft und stellten in Kriegszeiten beim Landesherrn zwei Pferde. Da sie ein flottes Leben liebten, so steckten sie bald tief in Schulden und verkauften deshalb 1725 das Gut an einem Kaufmann. Aber auch dieser konnte es nicht halten, so erwarb es 1743 der preußische Kriegs- und Domänenrat Otto von Schwachenberg, dem auch das Gut Schlebusch bei Silschede gehörte. Dieser ließ den verfallenen Rittersitz völlig erneuern und den verwilderten Park wieder in Ordnung bringen. Sein Sohn Dagmar hatte nur zwei Töchter, den die jüngste eine Freiherrn von Elberfeld heiratete und diesem das gut Schlebusch zu brachte, während die älteste, Henriette, Haus Hove bekam. Mit ihrem Mann, dem Kaufmann Karl Theodor Elbers in Barmen, lebte die geistig hochstehende Frau in unglücklicher Ehe. Nach der Scheidung derselben kehrte Henriette nach Hove zurück, nahm ihren Mädchennamen wieder an und widmete sich ganz der Erziehung ihrer beiden Kinder. Hier trat schon bald der junge Dichter Hoffmann von Fallersleben in ihren engeren Bekanntenkreis, und es entspann sich zwischen der 27 Jahre alten Frau und dem jungen Dichter ein inniges Freundschafts- und Liebesverhältnis, das in manchen Beziehungen an die Liebe Goethes zu Frau von Stein erinnert. Leider ist es zu wenig bekannt, so daß es von Interesse sein dürfte, daüber Näheres zu erfahren. Es war im Frühjahr 1820. Der 22-Jährige August Heinrich Hoffmann studierte an der Universität zu Bonn und kam mit seinem Freunde Wilhelm Hengstenberg aus Wetter in das Ruhrtal, um hier einige Tage seiner Ferien zu verbringen. Bei ihren gemeinschaftlichen Streifereien durch die schöne Gegend kamen sie auch nach Howe. In seinem Buche "Mein Leben" berichtet Hoffmann darüber wie folgt: "Die Frau vom Hause Henriette empfing und sehr freundlich, wir blieben den Nachmittag da waren sehr heiter und gingen erst am Abend wieder heim, so freundlich und liebenswürdig sie war, so blieb doch auf ihrem Gesicht die Trauer über ein verlorenes Jugendglück und ein Anflug unbefriedigter Sehnsucht und der Schmerz der Hoffnungslosigkeit.Ihr Schicksal hatte sie vorsichtig gemacht in der Wahl ihres Umganges und ängstlich in ihren Äußerungen mit Fremden. Es musste sie angenehm überraschen, jemanden vor sich zu sehen, der offen und halte sich über alles aus sprach, von dem sie für sich und ihr Schicksal Teilnahme erwarten durfte. Ich fühlte, dass ich ihr nicht gleichgültig war. Der Besuch wurde sehr bald wiederholt. Wir wurden immer freundlich ja aufgenommen, es wurde mir dort heimische, so dass ich ohne Wilhelm hingehen. Die Unterhaltung wurde dann sehr lebhaft und mannigfaltig. So wuchs unsere wechselseitige Neigung und wurde bei mir etwas leidenschaftlich. Henriette konnte das nicht fremd bleiben. Was ich nicht mündlich anzusprechen vermochte, warte ich schriftlich. Gehe ich Wetter verließ, erhielt Henriette meinen ersten Brief". Aber die Antwort lieb aus, wodurch die Liebe des jungen Dichters zu der Edelfrau nur noch gesteigert wurde. Er sehnte sich nach Hove, und im Juni kehrte er, von Bonn kommend, wieder dort ein um sich die Antwort auf seine Werbung zu holen. Aber obwohl Henriette die wärmsten Gefühle für ihn hatte, so wollte sie, gewitzt durch ihre trüben Erfahrungen, einer tiefen Liebe in ihrem Herzen keinen Raum geben. Seine Wiederkehr berührte sie peinlich, bald merkte er dass er auf Erfüllung seiner Bitte nicht rechnen konnte. Reiste wieder nach Bonn, und hier erreichten ihn bald zwei Briefe Henriettens, aus denen das tiefe Entsagen der jungen Frau so fühlbar spricht, " Weh tut mir der Gedanke, das durch mich ihre Ruhe und Zufriedenheit gestört ist, aber bei ruhigem Nachdenken werden sie es selbst fühlen, dass mein Besitz nie ihre Wünsche befriedigen und ihr Glück ausmachen kann." Sie spricht dann von ihrem enttäuschten Leben und bittet ihn, seine Empfindungen zu bekämpfen, damit er und sie Ruhe hätten und „dann schenken Sie der Frau, in die sie jetzt ein so hohes Vertrauen setzen, freundschaftliche Besinnung. Seien Sie überzeugt, dass mich nichts mehr erfreuen kann, als wenn ich vernehme, dass sie glücklich sind. Aber die tiefe Zuneigung zu Hoffmann blieb in ihrer Brust und erstarkte, bittet ihn um sein Bildnis, um ein Andenken an ihren Freund zu haben, sie sendet ihm Briefe über Briefe, schickt ihm kleine Handarbeiten und verzehrt sich, da sie keine Antwort erhält, in Sehnsucht nach ihm. Hoffentlich manchen morgen die Sonne aufgehen, ob mir der Tag keine Nachricht vom Freunde brächte. Lange hielt mich die Hoffnung, doch jetzt er löscht sie, mir bleibt nur die Erinnerung an eine schöne Zeit. Das letzte Lebenszeichen aus dieser Zeit erhielt sie 1821, indem ihr Hoffmann seine 1821 erschienenen "Lieder und Romanzen" mit der Widmung "Dir!" schickte. Was ihn abhielt, der Freundin zu antworten, war vor allem der Verdacht, Henriette hätte in ihrem adligen Standesdünkel ihn, den Bürgerlichen, verschmäht, aber damit tat er der von Vorurteilen freien Frau bitteres Unrecht.Dann streifte er ruhelos in Deutschland, Holland und Belgien umher und schwärmte dort in leichtem Sinn für schöne Frauen. Die dauernde Vernachlässigung machte im Herzen der Frau einer ruhigen Freundschaft Platz, und als 1826 ihr Vater starb, reichte sie dem Justizkommissar im späteren Landrat des Kreises Hagen Gustav Voerster die Hand zum Ehebunde. Unterdessen hatte Hoffmann von Fallersleben endlich einen Lehrstuhl für deutsche Literatur an der Universität zu Breslau erlangt, aber seine 1841 erschienenen "unpolitischen Lieder" brachten ihn um sein Amt. Seine Freunde und Gönner wandten sich von ihm ab, nur die Freundin aus dem Ruhrtal hatte Mitleid mit dem Geächteten. Sie nahm den Briefwechsel, der 14 Jahre geruht hatte, auf und schickte ihm 1842 einen recht herzlichen Brief, indem sie sich anbot, für ihn zu sorgen. "Sagen Sie mir offen, was Sie bedürfen, es ist für mich die schönste Freude, ihre Lage zu erleichtern. Ich habe ein altes, heiliges Recht auf ihr Vertrauen." Auf diesem Brief erhielt sie eine ebenso herzliche Antwort und endlich auch sein Bild, auf dass sie über 20 Jahre gewartet hatte. Bald sollte auch ihr sehnlichster Wunsch, den Jugendfreund wiederzusehen, erfüllt werden. Es war am 15. und 16. August 1843 in Laubach bei Koblenz, wo Henriette zur Kur weilte. Hoffmann schreibt darüber: "Ich sitze nach 25 Jahren wieder neben Henriette. Welche Erinnerungen! Ich muss ein altes Andenken annehmen - o, diese Liebe1" 2 Monate später kam er dann auf dringendes Bitten nach Hove und fand bald in dem Gatten seiner Freundin einen aufrichtigen, ehrlichen Charakter. Dann sah er Henriette 1844 noch einmal in Bad Königstein im Taunus. Im nächsten Jahre starb sie und ward in der Familiengruft auf dem Friedhof in Wengern begraben. Hoffmann, der in Mecklenburg weilte, erhielt diese Nachricht von ihrem Tode erst 4 Monate später. In stiller Stunde weihte er der Verstorbenen manche Träne "bis tief in die Nacht hinein", wie er in seinen Tagebüchern vermerkt. Als Gast hat er dann noch viermal auf Hove geweilt, zuletzt 1850 mit seiner jungen Frau, die er im Jahre vorher geheiratet hatte. Er starb 1870 zu Corvey an der Weser. Am 22. September 1920 hat man in feierlicher Weise an Haus Hove eine Gedenktafel mit dem Bilde Hoffmanns von Fallersleben angebracht. Im Schlossgarten aber steht noch die Zitterpappel, in deren Rinde vor 100 Jahren der schwärmerische Jüngling ein H, den Anfangsbuchstaben des Namens seiner Geliebten, einschnitt. Haus Hove kam 1868 durch Kauf an Dr. Strausberg in Hagen, 1873 an den Fabrikanten Hamacher in Barop und 1898 an den Fabrikbesitzer Bönnhoff in Wetter. Dieser ließ den zerfallenen Rittersitz ganz im Stile der alten Zeit wieder herstellen. Quelle: Lenhäuser, A.. Klöster, Burgen und feste Häuser an der Ruhr. Von Hohensyburg bis zur Ruhrmündung. Essen 1924
Kreis- und
Stadt-Handbücher des Westfälischen Heimatbundes:
|
|||