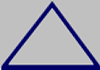«das Münster St. Kosmas und St. Damian in EssenBurgplatz |
|||
|
Stadt und Stift Essen verdanken ihre Entstehung dem Bischof Altfriedvon Hildesheim, der um 852 auf seinem väterlichen Erbe, den Hofe "asnide" ein Kirchlein und daneben ein Frauenkloster für die Töchter der sächsischen Adels errichtete. Doch muss festgehalten werden, dass diese Einrichtung kein Kloster im Sinne der heutigen Zeit gewesen ist. Von den Insassen, deren Zahl anfangs auf 50 berechnet war, legte nur die Äbtissin das Gelübde der Keuschheit ab, während die übrigen sich zwar zum gemeinsamen Gebet und Gottesdienst im Kloster einfinden mussten, im übrigen aber Privateigentum besitzen und erwerben durften, auch stand es ihnen frei, jederzeit wieder in die Welt zurückzutreten. So spricht man denn besser von einem freiweltlichen Kanonissenstift und den Stiftsdamen. Das Stift Essen erlangte schnell weiten Ruf und hohen Glanz, hauptsächlich durch seine Äbtissinnen, die den höchsten Kreisen des Adels entstammten und von denen einige sogar königlichen Geblütes waren. Nach und nach wurden ihm eine solche Menge Schenkungen an Gütern zuteil, dass es zu den reichsten im Reiche gehörte. Ee bezog den Zehnten von den Ländern zwischen Ruhr und Emscher, vom Papste erhielt es 947 das Recht der freien Äbtissinnenwahl und die Befreiung von der geistlichen Gerichtsbarkeit und vom Kaiser völlige Immunität von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit. Ausgestattet mit Reichtum an Land und Leuten und im Besitze einer großen Zahl von Privilegien, schwang sich das Stift in 400 jahren zu einer solchen Macht empor, dass es reichsunmittelbar wurde und die Äbtissin in einer Urkunde des Kaisers Heinrich VII. vom Jahre 1231 "Princeps" (Fürstin) genannt wurde. Die Fürstäbtissin besaß alle Hoheitsrechte, das Bergwerks, Zoll- und Münzregal, das Judengeleit u.a. und hatte Sitz und Stimme auf den deutschen Reichstagen. Die Vogtei des Stiftes lag anfänglich bei den Grafen von Altena und Berg, dann in den Händen Friedrichs von Isenberg, der seine Stellung, wie bereits gesagt wurde, mißbraucht und dadurch den Sturz seines Hauses herbeiführte; endlich kam sie an die Grafen von der Mark und dann an Preußen. Um die Burg, wie die Gebäude der Abtei genannt wurden, wickelte sich allmählich das Dorf "Essende" oder Essen. Im Jahre 926 wurde dies schon mit einer Pfahlhecke umgeben; als Stadt wird Essen zuerst 1243 genannt. War diese auch aus dem Stift hervorgegangen, so traten nach und nach zwischen beiden scharfe Unstimmigkeiten ein. Mit dem Aufblühen der Stadt Essen, wo neben Handel das Tuchmacher- und Büchsenmachergewerbe als besonders hervorragend genannt werden, erstarkte der Gemeinsinn der Bürger, die sich von der Landeshoheit der Fürstäbtissin freimachen wollten. Die Gegensätze verschärften sich, seit 1377 der Kaiser Karl IV. gelegentlich eines Besuches in Essen dieses zur "freien Reichsstadt" erhoben hatte. Streitigkeiten arteten allmählich in offene und tätliche Feindschaft aus, was zur Folge hatte, das verschiedene Äbtissinnen die Burg verließen und auf ihren Schlössern zu Borbeck und Steele Hof hielten. Stürmische und bewegte Zeiten waren die letzten Jahrzehnte des 16. und das ganze 17. Jahrhundert. Streitigkeiten zwischen Fürstin und Stift, zwischen Stift und der Stadt Essen, Religionswirren zwischen Katholiken, Lutheranern und Reformierten, dazu ein unaufhörliches Kriegstreiben füllten diese Jahre aus. 1583 führte der Krieg zwischen dem protestantisch wordenen Erzbischofe von Köln Gebhard von Waldenburg und seinem Nachfolger die Spanier ins Land; nach der Beendigung des Kölnischen Krieges wurde das Stift kriegsschauplatz zwischen Spanien und den Niederlanden; der 30jährige Krieg war bis 1629 in unserer Gegend ein offener Religionskrieg, dann folgten die französischen Raubkriege, bei denen das Hochstift sowohl als auch die Stadt essen unsägliches zu leiden hatten und völlig verarmten. Und auch das 18. Jahrhundert ließ die Gegensätze zwischen Stift und Stadt und den Konfessionen nicht erlöschen, wozu dann noch die Durchzüge, Einquartierungen und Requirierungen französischer und preußischer Truppen während des siebenjährigen Krieges kamen. So konnte auch die Stadt Essen keinen Aufschwung nehmen, kaum wieder erwachtes gewerbefleißiges Leben durch Partei- oder Religionshader oder Kriegsunruhen zugrunde ging. Erst aus den Trümmern des Stiftes erblühte schnell neues Leben. Als der Friede von Luneville (9. Februar 1801) den Rhein als Grenze zwischen Frankreich und Deutschland festsetzte, sollten die deutschen Fürsten für ihre Verluste auf der linken Rheinseite durch geistliche Stifter, die man säkularisierte, entschädigt werden. So kam das Hochstift Essen mit den Städten Essen und Steele, ein Gebiet von etwa 85 Quadratkilometer und 13000 Einwohnern, an Preußen. Nun begann der aufschwung der Stadt Essen, der sich der Stelle an den Namen krupp und seine Gussstahlfabrik knüpft. Der Begründer derselben Friedrich Krupp, der zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Essen eine kleine Schmiede betrieb und nebenher Versuche in der Bereitung eines Gußstahls betrieb, den bisher nur die Engländer verfertigten. 1816 hatte er das Geheimnis der Herstellung er gründet und errichtete nun im Westen der Stadt einen kleinen Schmelzbau. Aber die geschäftlichen blieben infolge mangelhafter finanzieller Unterstützung aus, und in seinen Hoffnungen getäuscht, starb Friedrich Krupp 1826 im besten Mannesalter, 39 Jahre alt. Sein Sohn Alfred, beim Tode des Vaters erst 14 Jahre alt, übernahm, anfänglich unter der Leitung seiner Mutter, des Vaters Werk, und durch umsichtiges Eingehen auf die neuesten Erfindungen auf dem Gebiete der Technik und Chemie, durch seine erstaunliche Willenskraft und Arbeitsfreudigkeit, die ihn jahrelang mit Schurzfell und Hammer ihn selbst arbeiten ließ, gelang es ihm, ein Walzwerk zur Anfertigung von Löffeln Gabeln zu bauen, dass ihm ansehnlichen Gewinn und die Mittel zur Vergrößerung seines Betriebes brachte. Eine weitere Erfindung war die Herstellung von ungeschweißten Radreifen und endlich seit den 40er Jahren das Verfahren, aus Gussstahl Gewehrläufe, Kanonen und sonstiges Kriegsmaterial herzustellen, wodurch er sich Weltruf verschaffte. 1887 starb er auf seiner Villa Hügel, die aus herrlichen wäldern weit in das schöne tal der Ruhr herabschaut. Sein Sohn Friedrich Alfred führte die Fabrik, die sich von Jahr zu Jahr vergrößerte und zu der eine Anzahl Zweigbetriebe, Kohlenzechen, Eisensteingruben und Hüttenwerke gehörten, zu ungeahnter Höhe. Als er 1902 starb, hinterließ er zwei Töchter. Die Fabrik wurde in eine Aktien-Gesellschaft umgewandelt. Nach dem Kriege 1914/18 musste die Herstellung von Kriegsmaterial aufgegeben werden, und so ist der gesamte Betrieb dann verhältnismäßig schnell auf die Herstellung von Erzeugnissen für Verkehrs- und gewerbliche Zwecke umgestellt worden. Die stete Zunahme der Kruppschen Fabrik auch die Stadt Essen zu einer Großstadt heranwachsen, die nach Einziehung verschiedener umliegender Gemeinden 470496 Einwohner zählt. Im Wappen hat die Stadt einen schwarzen gekrönten Reichsadler in goldenem Feld und daneben ein goldenes Schwert mit blauem Feld. Die Stadtfarben sind gold-blau. Unter den Kunstdenkmälern der Stadt ragt die ehrwürdige Stifts- oder Münsterkirche hervor, eines der ältesten christlichen Baudenkmäler. Sie ist eine Hallenkirche mit schmalen Seitenschiffen. Diese und das Chor sind gotisch, der Kuppelbau und die Krypta romanisch. Aus dem Vorhof, dem Paradies, in seiner ursprünglichen Form aus dem Ende des 10. Jahrhunderts stammend, gelangt man in den Westbau, " das geistreichst komponierte und sorgfältigst ausgeführte rheinische Bauwerk des 10. Jahrhunderts ". Er ist von rechteckiger Form, von einer Halbkugel überwölbt und hat drei Schiffe, worin ein dreiseitiger Chor eingefügt ist. Über demselben erhebt sich ein in ein Achteck übergehender, dreistöckiger Glockenturm. In einer Nische erblickt man eine Darstellung des Heiligen Grabes, eine Gruppe fast lebensgroßer figuren aus dem Jahre 1520. In der Krypta steht der Sarkophag des heiligen Altfried, vor dem Chöre ein siebenarmiger Leuchter, das Geschenk der Äbtissin Mathilde (973-1001). Im nördlichen Seitenchore ist der alte Hochaltar, ein Reliquienschrank mit Flügeln, aufgestellt. Er zeigt vier Gemälde von Barthel Brunn (1524): die Geburt Christi, die Anbetung der hl. drei Könige, die Kreuzigung und die Kreuzabnahme. Über der alten Taufkapelle liegt die goldene Kammer mit hervorragend seltenen Schatzstücken. Dazu gehören vier große Vortragskreuze in Email und mit Edelsteinen besetzt, ein aus Holz geschnitztes, mit Goldblech überzogenes Marienbild, die heiligen Kosmas und Damian, die Patrone des Stiftes Essen, aus getriebenem Silber, ein Evangelienbuch, mit ornamentaler Ausstattung aus vorkarolingischer Zeit, ein Prachtschwert mit byzantinischen Ornamenten geschmückt, das früher bei Aufzügen der Äbtissin als Zeichen ihrer ritterlichen Gewalt vorangetragen wurde, ferner eine Anzahl Reliquiare, Monstranzen, Kelche und Messgewänder. Von Interesse ist ein altes Kettenbuch, das die ältesten Abgaben der Essendischen Höfe enthält und seiner Wichtigkeit wegen an eine Kette angeschlossen war. Die Marktkirche, 1066 erbaut, hat am Ende des 15. Jahrhunderts eine umfangreiche Ausgestaltung erfahren. Den alten Abteigebäuden ist nur noch die ehemalige Kanzlei am Ende das Burgplatzes erhalten geblieben. Gegenüber liegt das Gymnasium, 1819 aus der Vereinigung der katholischen Stifts- und protestantischen Stadtschule hervorgegangen. Vom Essener Hochstift geht eine anmutige Sage. Zur Zeit, als Adelheid, die Schwester Kaiser Ottos II. dem Kloster vorstand, befand sich in ihrer Obhut die junge Nichte Mathilde, welche hier ihre Erziehung vollenden sollte. Aber diese sehnte sich hinaus aus den Klostermauern weit weg in die alte Krönungsstadt Aachen. Dort war ja der stattliche Pfalzgraf Ezzo von Niederlothringen, der beste Freund des jungen Kaisers Otto III., ihres Bruders. Mathilde trug stille Liebe zu Ezzo im Herzen, und auch dieser die hübsche Kaisertochter gerne als seine Gemahlin heimgeführt, wenn sich nicht zwischen ihnen so große Standesunterschiede geltend gemacht hätten. Da kam ihm der Zufall zu Hilfe, und ergriff schnell zu. Junge Kaiser liebte das Schachspiel sehr und wollte sich gern mit seinem Freunde Ezzo im Spiele messen. " Drei Spiele wollen wir machen, der Sieger mag sich erbitten, was er begehrt!", war bestimmt worden. Nun spielten beide, Otto in Zuversicht auf den Sieg, , Ezzo in Hoffnung der Erfüllung seines Herzenswunsches. Und er gewann das erste, zweite und dritte Spiel. Da jubelte Ezzo auf und brachte zaghaft seine Bitte um die Hand Mathildens vor. Otto sagte zu: " Du hast mein Wort! Hole dir die Braut!" Überglücklich schwang sich der Pfalzgraf auf sein Ross, und mit Windeseile ging es durch die Lande gen Essen zu. Der Äbtissin zeigte er Brief und Siegel des Kaisers, und bald wurde aus Ezzo und Mathilde ein glückliches Paar. An den Bau der schönen, altehrwürdigen Münsterkirche aber knüpft sich folgende Sage. Damals lebte im Stifte Essen eine mächtige Äbtissin. Zur Ehre Gottes wollte sie eine prachtvolle Kirche errichten, und kein Opfer war ihr dafür zu groß. Bei einer Wallfahrt nach Rom entdeckte sie eine prachtvolle Marmorsäule, die ihr auf vieles Bitten geschenkt wurde. Dankbar nahm sie die Gabe an, aber sie war ratlos, wie sie dieselbe aus so weiter Ferne nach Essen bringen könne. Da nahte sich ihr der Teufel und erbot sich, das Werk zu vollbringen, wofür ihm die Äbtissin ihre Seele verschreiben sollte. Nach langem Sträuben willigte diese ein, doch wurde als Bedingung gemacht, dass die Säule am Tage vor dem Dreikönigsfeste pünktlich zur Zeit des Aveläutens in der Münsterkirche stehen müsse. Die Äbtissin reiste heim, von schweren Gewissensbissen gefoltert. In ihrer Not bat sie Gott um Hilfe und hielt mit den Stiftsdamen gemeinsame Gebete um Abwendung der Gefahr. Doch der Teufel war auf dem Wege und in der Nähe von Essen angelangt. Da er noch etwas Zeit hatte, so setzte er sich mit seiner Last am Kalkhofteich vor dem Kettwigertor nieder. Aber, o Wunder! Plötzlich fingen die Glocken des Münsters ihr Avegeläut an. Der Teufel, in höchstem Maße ergrimmt, dass er eine Seele verloren hatte, warf die Säule zu Boden, daß sie barst und verschwand dann. Die Äbtissin aber ließ sie im Westchor des Münsters aufstellen, wo sie heute noch als Zierde steht. Zum Andenken an ihre wunderbare Rettung aus Hand des Höllenfürsten bestimmte sie, daß alljährlich Dreikönigsabend am Kalkhofsteich den Armen der Stadt eine Schüssel Reisbrei gespendet werde.
|
|||